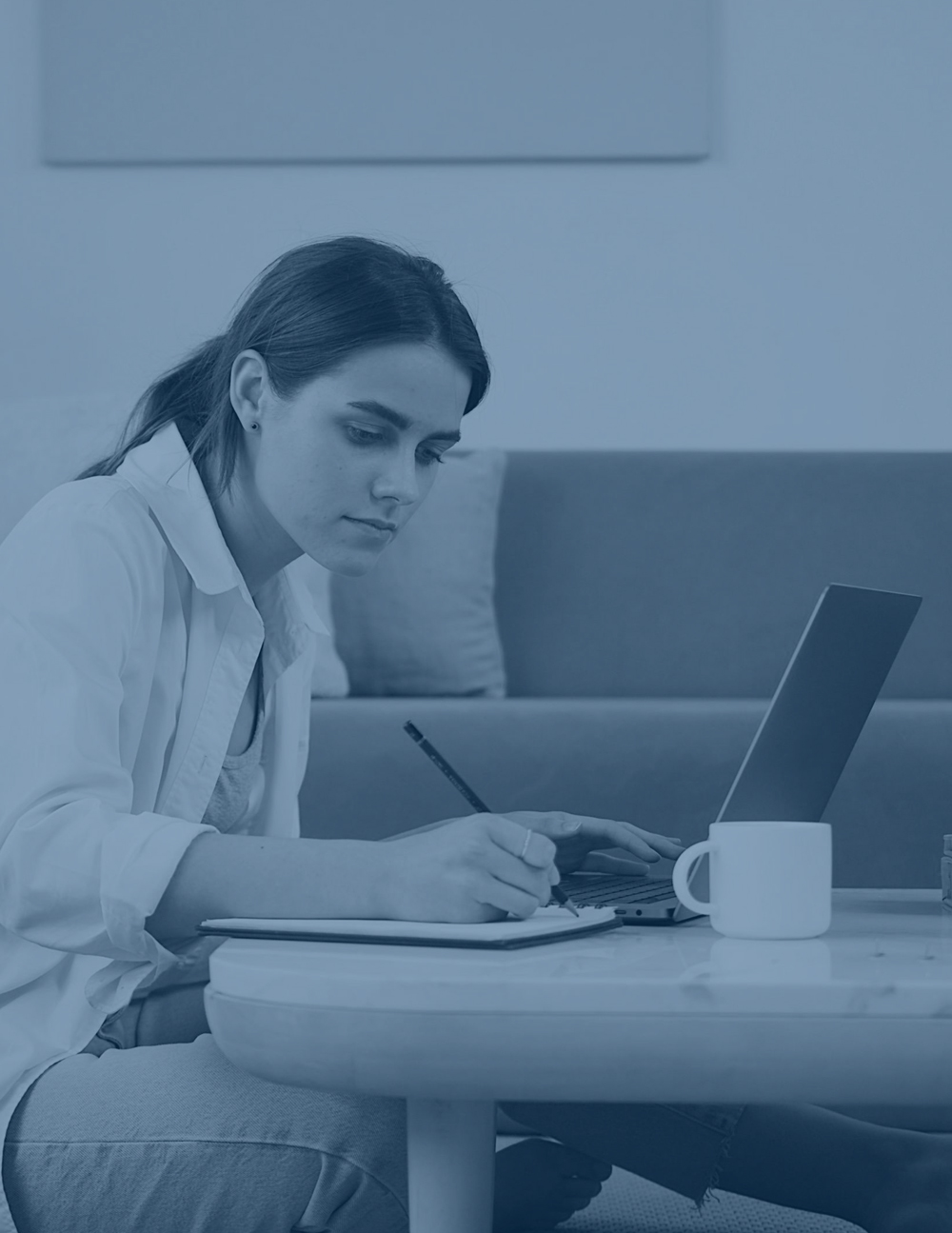Veräußerungsgewinn bei teilentgeltlicher Grundstücksübertragung mit Übernahme von Schulden im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
Ein bebautes Grundstück wurde im Jahr 2014 für insgesamt 143.950 Euro erworben und anschließend vermietet. Einen Teil des Erwerbs hatte der Erwerber durch ein Bankdarlehen finanziert. Im Jahr 2019 übertrug er diese Immobilie im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf seine Tochter. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Grundstück einen Wert von 210.000 Euro. Die Tochter übernahm die am Übertragungstag bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 115.000 Euro. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung berücksichtigte das beklagte Finanzamt diesen Vorgang als nach § 23 EStG steuerpflichtiges „privates Veräußerungsgeschäft“. Es teilte ausgehend vom Verkehrswert im Zeitpunkt der Übertragung den Vorgang in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf. Soweit das Grundstück unter Übernahme der Verbindlichkeiten entgeltlich übertragen worden war, besteuerte es den Vorgang als privates Veräußerungsgeschäft und setzte die entsprechende Einkommensteuer gegenüber dem Vater fest.
Der Bundesfinanzhof hat die vom Finanzamt vorgenommene Besteuerung der Grundstücksübertragung unter Übernahme von Schulden bestätigt: Wird ein Wirtschaftsgut übertragen und werden zugleich damit zusammenhängende Verbindlichkeiten übernommen, liegt regelmäßig ein teilentgeltlicher Vorgang vor. In diesem Fall erfolgt eine Aufteilung in einen entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Teil. Wird das Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertragen, unterfällt der Vorgang hinsichtlich des entgeltlichen Teils als privates Veräußerungsgeschäft der Einkommensteuer (Az. IX R 17/24).
Neue Regeln für die steuerliche Behandlung von Kryptowerten
An Privatanleger werden strenge Anforderungen gestellt, da diese für die steuerliche Aufarbeitung der einzelnen Veräußerungsgeschäfte verantwortlich sind.
Das Bundesministerium der Finanzen hat in seinem Schreiben vom 06.03.2025 seine bisherigen Erläuterungen zur ertragsteuerlichen Behandlung von Kryptowerten (z. B. Bitcoin) aktualisiert und schwerpunktmäßig um Ausführungen zu den Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten der Krypto-Anlegerinnen und -Anleger erweitert (Az. IV C 1 – S 2256/00042/064/043). Mit dem Schreiben erhalten u. a. Steuerpflichtige eine Hilfestellung bei der Dokumentation und Erklärung ihrer Einkünfte.
Neben der ausführlichen Darstellung der Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten wurden einzelne Sachverhaltsdarstellungen und Regelungen in den Kapiteln des bestehenden BMF-Schreibens ergänzt. Dies betrifft insbesondere die sog. Steuerreports, aber etwa auch das Claiming von Kryptowerten und den Ansatz von sekundengenauen und Tageskursen.
Das Bundesministerium der Finanzen empfiehlt die Nutzung eines Steuerreports: Zur besseren Nachvollziehbarkeit steuerlicher Vorgänge betont es die Bedeutung detaillierter Transaktionsübersichten. Die Nachvollziehbarkeit könne über Steuerreports gewährleistet werden, wenn diese bei der Bearbeitung plausibel erscheinen, weil keine Hinweise auf eine Unvollständigkeit vorliegen. Daher sollten Steuerpflichtige die sog. Steuerreports nutzen, um ihre Krypto-Aktivitäten transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren.
In seinem Schreiben listet das Bundesministerium der Finanzen u. a. auch auf, welche Unterlagen und Daten von privaten Kapitalanlegern für Steuerzwecke angefordert werden können. Krypto-Anleger sollten diese Daten regelmäßig sammeln und übermitteln können, um Gewinnschätzungen zu vermeiden. Es ist essenziell, alle relevanten Unterlagen und Nachweise zu Krypto-Transaktionen vollständig und sorgfältig zu dokumentieren und aufzubewahren, um den steuerlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Hinweis
Non Fungible Token (NFT) und das sog. Liquidity Mining sind noch nicht Gegenstand dieses BMF-Schreibens. Das BMF wird sich weiterhin mit den entsprechenden ertragsteuerlichen Fragen rund um Kryptowerte befassen und das Schreiben sukzessive ergänzen.
Vorsteuerabzug bei Sachgründung einer GmbH durch Sacheinlage
Im vorliegenden Fall gründete die alleinige Gesellschafter-Geschäftsführerin (eine zuvor nicht unternehmerisch tätige natürliche Person) die GmbH nicht in bar, sondern im Wege der Sachgründung. Nach Abschluss des Gesellschaftsvertrags erwarb sie dafür einen Pkw und brachte diesen im Rahmen der Sachgründung in die GmbH ein, die danach in das Handelsregister eingetragen wurde. Die Rechnung mit Umsatzsteuer war an die Gesellschafterin unter der späteren Geschäftsanschrift der Gesellschaft adressiert, die von der Wohnanschrift der Gesellschafterin abwich. Die GmbH ordnete den Pkw für Umsatzsteuerzwecke ihrem Unternehmen zu, nutzte das Fahrzeug ausschließlich unternehmerisch für ihre wirtschaftliche Tätigkeit und machte auch den Vorsteuerabzug für den Erwerb des Pkw geltend. Das Finanzamt verwehrte der GmbH den Vorsteuerabzug, da es sich um einen Erwerbsvorgang im Privatvermögen der Gesellschafterin gehandelt habe. Dies belege die Rechnung. Die Richter des Niedersächsischen Finanzgerichts gaben der hiergegen gerichteten Klage der GmbH statt, denn nach dem Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer stehe der Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des Pkw der GmbH zu, sofern die Gründungsgesellschafterin selbst nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sei (Az. 5 K 111/24). Der Gesellschafterin habe kein Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des Pkw zugestanden. Insofern habe umsatzsteuerlich jedoch eine personenübergreifende Zurechnung in der Unternehmensgründungsphase zu erfolgen. Dem stehe nach Auffassung des Finanzgerichts auch nicht entgegen, dass die diesbezügliche Rechnung an die Gründungsgesellschafterin unter der Geschäftsanschrift der GmbH adressiert war. Die Richter berücksichtigten dabei die Argumentation in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu einem Fall in Polen (Rs. C-280/10 Polski Trawertyn), die auf den vorliegenden Streitfall übertragbar sei.
Umsatzsteuer in der Systemgastronomie – Preisaufteilungsmethoden bei Kombi-Angeboten
Getränke und Speisen in der Systemgastronomie unterliegen unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen – aber was gilt dann für ein typisches Spar-Menü (z. B. aus Burger, Pommes und Getränk)? Der Bundesfinanzhof hat das Lieblingsmodell („Food-and- Paper“-Methode) der Systemgastronomie mit einer aktuellen Entscheidung zurechtgestutzt. Die Richter entschieden, dass eine Methode zur Aufteilung des Verkaufspreises eines Spar-Menüs, die dazu führt, dass auf ein Produkt des Spar- Menüs ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, der höher ist als der Einzelverkaufspreis, nicht sachgerecht ist (Az. XI R 19/23).
Im Streitfall betrieben zwei GmbHs als Franchisenehmerinnen Schnellrestaurants, in denen u. a. Spar-Menüs zu einem einheitlichen Gesamtpreis zum Verzehr außer Haus verkauft wurden. Umsatzsteuerrechtlich handelte es sich dabei, wie der Bundesfinanzhof bestätigt hat, um zwei Lieferungen: Die Lieferung des Getränks unterliegt dem Regelsteuersatz (19 %) und die Lieferung der Speisen unterliegt dem ermäßigten Steuersatz (7 %).
Seit dem 01.07.2014 teilten die beiden GmbHs den Gesamtpreis des Spar-Menüs nach der „Food-and-Paper“-Methode auf die Speisen und das Getränk auf. Die Aufteilung erfolgt dabei anhand des Wareneinsatzes, das heißt der Summe aller Aufwendungen für die Speisen bzw. für das Getränk.
Da in der Gastronomie die Gewinnspanne auf Getränke typischerweise deutlich höher ist als die Gewinnspanne auf Speisen, ergäbe sich hieraus typischerweise eine niedrigere Umsatzsteuer als bei einer Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen. Das beklagte Finanzamt hielt die Aufteilung nach der „Food- and-Paper“-Methode für unzulässig, weil sie nicht so einfach sei, wie eine Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen und außerdem nicht zu sachgerechten Ergebnissen führe. Das Finanzgericht Baden-Württemberg hielt die „Food-and-Paper“-Methode hingegen für zulässig.
Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung des Finanzgerichts im Ergebnis nicht. Er führte zwar zunächst aus, dass – entgegen der Auffassung des Finanzamts – der Unternehmer nicht immer die einfachstmögliche Methode anwenden muss. Wenn eine andere Methode zumindest ebenso sachgerecht sei wie die Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen, dürfe er auch die andere Methode anwenden. Der Bundesfinanzhof erkannte die „Food-and-Paper“-Methode nicht an, weil sie in manchen Fällen dazu führt, dass der Preis eines Burgers mit einem hohen Wareneinsatz im Menü über dem Einzelverkaufspreis des Burgers liegen würde. Es widerspricht aus Sicht des Bundesfinanzhofs der wirtschaftlichen Realität, dass der Verkaufspreis eines Produkts in einem mit Rabatt verkauften Menü höher sein könnte als der Einzelverkaufspreis. Eine Methode, die dazu führe, sei nicht sachgerecht.

Umsatzsteuer auf Betriebskosten bei Vermietung von Sondereigentum
Ein Mieter von Gewerberäumen, der zum Vorsteuerabzug berechtigt war, verlangte von seinem Vermieter die Rückzahlung von Betriebskosten. Er hatte die in einer Wohnungseigentumsanlage gelegene Teileigentumseinheit zum Betrieb eines Friseursalons vom Sondereigentümer der Einheit gemietet. Der Vermieter hatte zur Umsatzsteuer optiert, die Wohnungseigentümergemeinschaft hingegen nicht. Für die Betriebskostenabrechnung 2018 übernahm der Vermieter die Kostenpositionen aus der Jahresabrechnung der Wohnungseigentümergemeinschaft inklusive der darin enthaltenen Umsatzsteuer und berechnete darauf zusätzlich 19 Prozent Umsatzsteuer. Aus der Betriebskostenabrechnung ergab sich eine Nachzahlung in Höhe von 964 Euro (inklusive 154 Euro Umsatzsteuer) die der Mieter zunächst bezahlte. Nun verlangte der Mieter die Rückzahlung von 732 Euro. Er war der Ansicht, der Vermieter hätte die in den Kostenpositionen enthaltene Umsatzsteuer herausrechnen müssen und nur auf die Netto-Beträge Umsatzsteuer aufschlagen dürfen. Das Amtsgericht gab der Klage in der Hauptsache statt; das Landgericht wies sie ab.
Die Revision des Mieters blieb vor dem Bundesgerichtshof erfolglos (Az. XII ZR 29/24). Vorliegend sei die Betriebskostenabrechnung inhaltlich korrekt. Insbesondere müsse der Vermieter die Umsatzsteuer nicht herausrechnen. Dies beruhe darauf, dass es sich bei den Mieträumen um eine Teileigentumseinheit in einer Wohnungseigentumsanlage handelt und der Vermieter seinerseits keinen Vorsteuerabzug gelten machen kann.
Gewerblicher Grundstückshandel: Ausnahme bei erweiterter Kürzung und Drei-Objekt-Grenze
Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass die sog. Drei-Objekt-Grenze keine starre Regel ist. Nach der ständigen Rechtsprechung liegt ein der erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes entgegenstehender gewerblicher Grundstückshandel im Regelfall dann vor, wenn innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs von in der Regel fünf Jahren mehr als drei Objekte veräußert werden (sog. Drei-Objekt-Grenze). Wie der Bundesfinanzhof entschied, kann aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls ein gewerblicher Grundstückshandel zu verneinen und die erweiterte Kürzung zu gewähren sein, wenn innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums weder Grundstücksveräußerungen noch diese vorbereitenden Maßnahmen erfolgen und erst im sechsten Jahr eine zweistellige Anzahl von Objekten veräußert wird (Az. III R 14/23).
Im Streitfall war die Klägerin eine in eine Immobilienkonzernstruktur eingegliederte GmbH. Zunächst hatte sie zwei Geschäftsführer, die Gesellschafter der Holdinggesellschaft waren. Nach dem Erwerb mehrerer Vermietungsobjekte im Jahr 2007 verstarb einer der Geschäftsführer im Jahr 2012 überraschend. Daraufhin veräußerte die Klägerin im Jahr 2013 dreizehn Immobilien. Das beklagte Finanzamt ging deshalb davon aus, dass die Klägerin von Beginn an einen gewerblichen Grundstückshandel betrieben hat und daher schon im Jahr 2011 keinen Anspruch auf die erweiterte Kürzung hat. Das Finanzgericht Münster gab der Klage statt und stellte insbesondere darauf ab, dass aus der hohen Anzahl von Veräußerungen allein noch keine bedingte Veräußerungsabsicht im Erwerbszeitpunkt abzuleiten sei.
Der Bundesfinanzhof wies die Revision des Finanzamts als unbegründet zurück. Der Fünf-Jahres-Zeitraum sei zwar keine starre Grenze, bei Grundstücksveräußerungen nach Ablauf von mehr als fünf Jahren und besonders bei erstmaligen Veräußerungen danach müssten jedoch weitere Beweisanzeichen hinzutreten, um von Anfang an einen gewerblichen Grundstückshandel zu bejahen. Die Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls durch das Finanzgericht sei nicht zu beanstanden und widerspreche nicht früheren Entscheidungen des Bundesfinanzhofs. Eine hohe Zahl von Veräußerungen außerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums oder eine hauptberufliche Tätigkeit im Baubereich führe nicht zwingend zu einem gewerblichen Grundstückshandel. Vielmehr habe das Finanzgericht auch den überraschenden Todesfall als besonderen Umstand des Einzelfalls berücksichtigen dürfen.
Ablauf des Zwangsgelderverfahrens für verspätete Steuererklärungen
Laut den Finanzämtern (deutschlandweit) läuft das Zwangsgelderverfahren für
verspätete Steuererklärungen in zwei Phasen ab:
- Androhung – meist nach Ablauf der regulären Frist (für 2023 zuletzt 2. September 2024, bzw. 2. Juni 2025 für steuerlich beraten) wird eine Frist gesetzt.
- Festsetzung (1. Tranche) – erfolgt, wenn die Androhungsfrist verstrichen ist, typischerweise kurz darauf. Anschließend kann es (2. Tranche) zu einer weiteren Androhung kommen, wenn weiterhin keine Steuererklärung eingereicht wurde.
Eine konkrete zeitliche Zuordnung („Ende Juni“ und „Mitte Juli“) wird von Bundes- oder Landesämtern nicht national vorgegeben – vielmehr ist dies eine typische Praxis vieler Finanzämter, um nach Ablauf der Abgabefrist sukzessive gegen die Steuerzahler vorzugehen. Der genaue Versandzeitpunkt kann jedoch je nach Bundesland und Amt variieren.
Hinweis
Will man herausfinden, wie verschiedene Ämter konkret verfahren (z. B. in Bayern), lohnt sich eine direkte Nachfrage beim zuständigen Finanzamt – oder ein Blick auf dessen Online-Portal.
Beispiel: nach einer Information des Zentralfinanzamts Nürnberg werden Zwangsgeldandrohungen für die Steuererklärungen 2023 Ende Juni (1. Tranche) und Mitte Juli (2. Tranche) versendet.
Anhängige Musterverfahren: Kein Vorläufigkeitsvermerk bei der Festsetzung des Solidaritätszuschlags
Das Bundesministerium der Finanzen hat infolge höchstrichterlicher Rechtsprechung beschlossen, die Anweisung zur vorläufigen Festsetzung des Solidaritätszuschlags aufzuheben (Az. IV D 1 – S 0338/00083/001/099).
Ein Vorläufigkeitsvermerk im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit und verfassungskonforme Auslegung der Norm erfolgt für Steuerfestsetzungen im Hinblick auf folgende Punkte:
- Höhe der kindbezogenen Freibeträge (§ 32 Abs. 6 Satz 1 und 2
Einkommensteuergesetz – EStG),
- Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungsverluste (§ 20 Abs. 6 Satz 4 EStG (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG a. F.)) und
- Höhe des Grundfreibetrags (§ 32a Abs. 1 Satz 2 EStG).
Ein Vorläufigkeitsvermerk lässt einen Steuerbescheid in bestimmten Punkten offen.
Hinweis
Das Bundesverfassungsgericht hat im März 2025 entschieden (Az. 2 BvR
1505/20), dass gegenwärtig keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Erhebung des Solidaritätszuschlags nach dem Auslaufen des Solidarpakts zum 31.12.2019 bestehen. Hierauf reagierte die Finanzverwaltung, indem es die Anweisung zur vorläufigen Steuerfestsetzung aufhob.
Freiwillige Beiträge zählen nicht für die Grundrente
Ein Rentner hatte geklagt, weil die Deutsche Rentenversicherung seinen Antrag auf Berücksichtigung eines Grundrentenzuschlags abgelehnt hatte. Sie war der Ansicht, statt der erforderlichen 396 Monate (entspricht 33 Jahren) lägen nur 230 Monate mit Pflichtbeiträgen vor. Die vom Kläger während seiner selbstständigen Tätigkeit freiwillig entrichteten Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung über 312 Monate zählten nicht zu den Grundrentenzeiten. Das Sozialgericht Mannheim und das Landessozialgericht Baden-Württemberg teilten die Ansicht der Deutschen Rentenversicherung. Der Rentner hingegen argumentierte, er habe mit seinen freiwilligen Beiträgen viele Jahre zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung beigetragen und müsse wie Pflichtversicherte auf eine ordentliche Absicherung im Alter vertrauen dürfen.
Das Bundessozialgericht folgte der Einschätzung der Vorinstanzen und wies die Revision zurück (Az. B 5 R 3/24 R). Es liegen weder ein Verstoß gegen Verfassungsrecht noch gegen den allgemeinen Gleichheitssatz vor. Die Ungleichbehandlung sei sachlich gerechtfertigt. Im Gegensatz zu freiwillig Versicherten könnten sich Pflichtversicherte ihrer Beitragspflicht nicht entziehen. Sie trügen regelmäßig durch längere Beitragszeiten und höhere Beiträge in wesentlich stärkerem Maße zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung bei. Zwar könne auch bei freiwillig Versicherten die Situation eintreten, dass sie trotz langjähriger, aber geringer Beitragsleistung keine auskömmliche Altersversorgung aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben. In der Folge müssten sie bei bestehender Hilfebedürftigkeit im Alter Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Dass der Gesetzgeber in erster Linie Versicherte begünstigen wollte, die langjährig verpflichtend Beiträge aus unterdurchschnittlichen Arbeitsverdiensten gezahlt haben, sei nicht zu beanstanden.
„Wassercent“: Wasserverbrauchssteuer rechtlich nicht zu beanstanden
Die Stadt Wiesbaden darf den „Wassercent“ – eine Extrasteuer – einführen. Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) hatte der Stadt die Wasserverbrauchssteuer zunächst verboten: zu Unrecht, wie jetzt das Verwaltungsgericht Wiesbaden urteilte (Az. 7 K 941/24.WI).
Neben der Wassergebühr sollten die Bürger zusätzlich auf jeden verbrauchten Kubikmeter Trinkwasser 0,90 Euro Steuer zahlen. Zweck der Steuer sei neben der Finanzierung des kommunalen Haushalts die Schaffung von Anreizen zum sparsamen Umgang mit Wasser. Das HMdI hielt die Erhebung der Extrasteuer für rechtswidrig.
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist die Erhebung einer Wasserverbrauchssteuer nicht zu beanstanden. Der Umstand, dass lebensnotwendige Güter wie Trinkwasser nicht besteuert werden dürften, sei kein geltender Rechtsgrundsatz, wie das Beispiel der Umsatzsteuer zeige. Die Höhe der Steuer sei hoch genug, um Lenkungseffekte zu erzielen, ohne aber zu einer erdrosselnden Wirkung zu führen.

Hinweis
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat nach eigener Aussage die Berufung zum Hessischen Verwaltungsgerichtshof zugelassen, „weil es sich bei der Zulässigkeit einer kommunalen Wasserverbrauchssteuer um eine grundlegende Frage handelt, die von der Rechtsprechung noch nicht entschieden worden ist“. Geht das Land Hessen nicht in Berufung, können die Stadtverordneten entscheiden, ab wann der „Wassercent“ erhoben wird.
Termine Steuern/Sozialversicherung
|
Steuerart |
Fälligkeit |
||
|
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag |
10.07.2025 (1) |
11.08.2025 (2) |
|
|
Umsatzsteuer |
10.07.2025 (3) |
11.08.2025 (4) |
|
|
Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei Zahlung durch: |
Überweisung (5) |
14.07.2025 |
14.08.2025 |
|
Scheck (6) |
10.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Gewerbesteuer |
entfällt |
15.08.2025 (8) |
|
|
Grundsteuer |
entfällt |
15.08.2025 (8) |
|
|
Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei Zahlung durch: |
Überweisung (5) |
entfällt |
18.08.2025c |
|
Scheck (6) |
entfällt |
15.08.2025 |
|
|
Sozialversicherung (7) |
29.07.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag |
Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. |
||
- Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
- Für den abgelaufenen Monat.
- Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
- Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
- Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
- Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
- Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2025/25.08.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
- In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2025 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 18.08.2025 fällig und der Ablauf der Schonfrist fällt auf den 21.08.